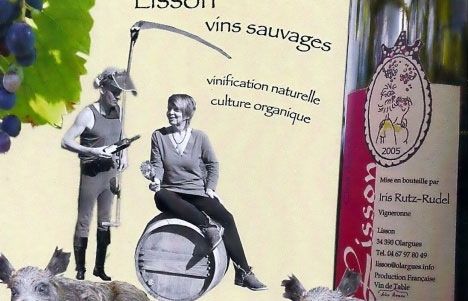Der Text des in Frankreich so berühmten und populären Chansons hat in diesem Jahr wieder neben der Süße der Früchte einen etwas bitteren Beigeschmack für die Bauern in unserem Tal angenommen. Vielleicht hatten Liebende Ende Mai/Anfang Juni Sonne im Herzen, am Himmel war sie dagegen seltener zu sehen und das jährliche Kirschenfest in Mons la Trivalle soff regelrecht ab, so, wie schon eine Woche vorher das Rosenfest in Vieussan. Und die Kirschen, die in vielen Jahren den Bauern mehr Einnahmen brachten, als die PfennigCentbeträge, die man ihnen für ihre Trauben in der Winzergenossenschaft zahlt - haben soviel Wasser oft nicht standhalten können - wieder einmal eine arg dezimierte Ernte und ein harter Schlag für die heimische Ökonomie.

Die Burlat eine saftvolle und tiefschwarze Kirsche köstlich frisch vom Baum aber auch ideal für Clafoutis und Konfitüre, wurde Mitte Mai gerade erst an den kleinen improvisierten Verkaufsständen entlang der Straße zwischen Saint Pons und Bédarieux angeboten, als das Regenwetter begann. Auch wenn die Reben in Lisson diese feuchte Periode gut überstanden haben, so waren doch die schwarzen Kirschen zu empfindlich, auch wiederholte Gewitterregen zu überstehen und verfaulten, noch ehe sie geerntet werden konnten, auf den Bäumen.
Blieb noch die Hoffnung, eine gute Ernte der später reifen Weißkirschen einzubringen, die man in den 80ger Jahren zahlreich gepflanzt hatte, weil damals große Mengen im Export verlangt wurden. Sie waren es vor allem, die den Einsatz von bunten Banden von Saisonkräften benötigten, die ab Anfang Juni für einige Wochen die Dörfer aus ihrem Winterschlaf weckten.

Hauptfeind zu dieser Zeit war die Kirschfliege, die ihre Larven in die Kirschen legt und so für den Wurm in den spätreifen Weißkirschen verantwortlich ist, den wir alle nicht so sehr schätzen, so wir ihn denn sehen, bevor wir eine Frucht verspeisen. Jahrelang wurde so vor allem bis zu 14 Tage vor der Ernte (in der Schweiz mußte man 3 Wochen Abstand halten) mit recht virulenten Insektenvernichtungsmitteln gespritzt. Warnungen vor der Schädlichkeit der Produkte wurden dann gerne mit dem Hinweis auf die spätere rabiate Verarbeitung der Früchte in Deutschland abgetan - allenfalls versicherte man, dass man den Baum für die Familie eben nicht spritze... und lange Zeit wurden wir als verrückt ausgelacht, wenn wir unsere damals mühsam aus der Schweiz importieren gelben Plastikfliegenfallen in die Bäume hingen, die heute überall zu haben sind. Was zählte, war das sichere Einkommen, das half, den Niedergang der Esskastanien und des Weinbaus auszugleichen, die schon lange in der Krise waren.
Die majestätischen großen Bäume, die zur Blütezeit die Chaussee mit ihren weißen Schmuck in einer durchgehenden Allee schmückten, wurden nach und nach immer seltener, - mangelnde Pflege, Schädlingsbefall und schließlich die anhaltende große Trockenheit mit ihrem Höhepunkt im Sommer 2003 ließen sie absterben - sie wurden abgeholzt, bevor noch die neue, prämierte Rodungswelle für Weinflächen seit zwei Jahren einen weiteren Teil der Kulturlandschaft ergriffen hat.
In diesem Jahr vom Frost verschont, wurden die Kirschen doch noch Opfer der Gewitterregen, die sie erst anschwellen und dann platzen ließen.
Ein trauriger Anblick, all diese nicht abgeernteten Bäume mit den Früchten, die verrotten, die sterbenden Riesen und die ausgerissenen Weinfelder häufen sich - die letzte Strophe des alten Liedes nimmt noch eine neue Bedeutung an.
J’aimerai toujours le temps des cerises
C’est de ce temps-là que je garde au cœur
Une plaie ouverte …
Et Dame Fortune, en m’étant offerte
Ne pourra jamais fermer ma douleur
J’aimerai toujours le temps des cerises
Et le souvenir que je garde au cœur.
Epilogue:

Aber zum Abschluss und Trost noch ein Bild vom letzten Clafoutis dieser Saison, dem traditionellen Nachtisch in der Kirschenzeit.
Das Rezept ähnelt dem eines dickflüssigen Pfannkuchenteigs - Eier, Zucker, eine Prise Salz, Mehl und Milch nacheinander vermengen, eine Zeit ruhen lassen, während der man eine Form ausbuttert und die Kirschen einfüllt (es gibt die Schule: immer mit Stein - und die: lieber ohne - ich gehöre inzwischen zur Letzteren - wobei ich allen praktischen Küchenhelfern die alte Methode mit meinen kräftigen Daumennägeln zum Entsteinen vorziehe - auch wenn bei den vollreifen schwarzen Kirschen die Finger sehr gut die Farbe annehmen - das bin ich als Winzerin ja von der Maische gewohnt...)
Beim obigen Modell kam als kleiner Trick zuletzt noch ein Schuss Champagner, der noch in der Flasche war, in den Teig - das läßt ihn höher aufgehen - geht natürlich auch mit einem Schuß Sprudel - aber jeder hat so seine Ressourcen...

PS:
Jeder hat da sicher seine eigene Referenz, wenn er noch das Glück hat, vollreife Kirschen direkt vom Baum vor dem Haus oder in der Nachbarschaft pflücken zu können. Wer nur noch mit den künstlichen Aromastoffen der Milchprodukte aus dem Supermarkt aufgewachsen ist, muss da eine ganz andere Vorstellung haben und wird sich so wohl auch leicht von mit Aromahefen vinifizierten Massenweinen einfangen lassen... aber das ist noch eine andere Diskussion.